


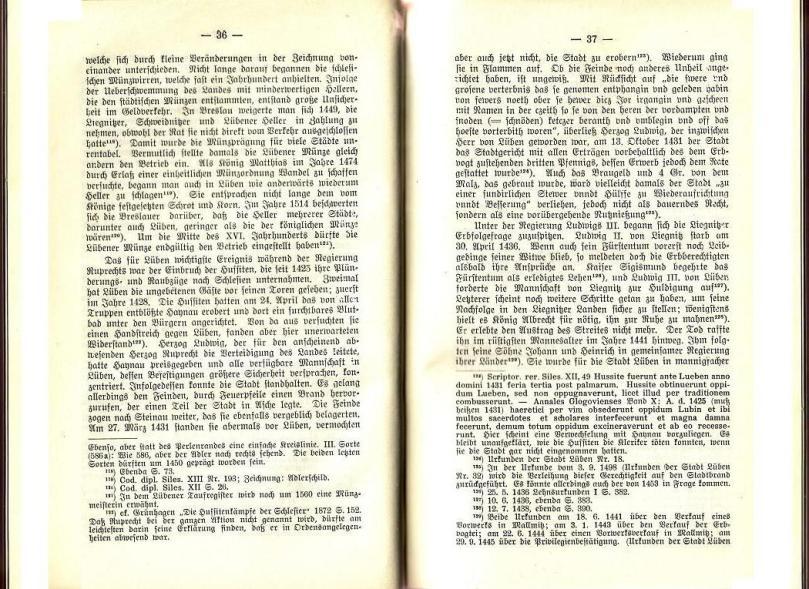
|
- 36 - welche sich durch kleine Veränderungen in der Zeichnung von- einander unterschieden. Nicht lange darauf begannen die schlesi- schen Münzwirren, welche fast ein Jahrhundert anhielten. Infolge der Ueberschwemmung des Landes mit minderwertigen Hellern, die den städtischen Münzen entstammten, entstand große Unsicher- heit im Geldverkehr. In Breslau weigerte man sich 1449, die Liegnitzer, Schweidnitzer und Lübener Heller in Zahlung zu nehmen, obwohl der Rat sie nicht direkt vom Verkehr ausgeschlossen hatte118). Damit wurde die Münzprägung für viele Städte un- rentabel. Vermutlich stellte damals die Lübener Münze gleich andern den Betrieb ein. Als König Matthias im Jahre 1474 durch Erlaß einer einheitlichen Münzordnung Wandel zu schaffen versuchte, begann man auch in Lüben wie anderwärts wiederum Heller zu schlagen119). Sie entsprachen nicht lange dem vom Könige festgesetzten Schrot und Korn. Im Jahre 1514 beschwerten sich die Breslauer darüber, daß die Heller mehrerer Städte, darunter auch Lüben, geringer als die der königlichen Münze wären120). Um die Mitte des XVI. Jahrhunderts durfte die Lübener Münze endgültig den Betrieb eingestellt haben121). Das für Lüben wichtigste Ereignis während der Regierung Ruprechts war der Einbruch der Hussiten, die seit 1425 ihre Plün- derungs- und Raubzüge nach Schlesien unternahmen. Zweimal hat Lüben die ungebetenen Gäste vor seinen Toren gesehen; zuerst im Jahre 1428. Die Hussiten hatten am 24. April das von allen Truppen entblößte Haynau erobert und dort ein furchtbares Blut- bad unter den Bürgern angerichtet. Von da aus versuchten sie einen Handstreich gegen Lüben, fanden aber hier unerwarteten Widerstand122). Herzog Ludwig, der für den anscheinend ab- wesenden Herzog Ruprecht die Verteidigung des Landes leitete, hatte Haynau preisgegeben und alle verfügbare Mannschaft in Lüben, dessen Befestigungen größere Sicherheit versprachen, kon- zentriert. Infolgedessen konnte die Stadt standhalten. Es gelang allerdings den Feinden, durch Feuerpfeile einen Brand hervor- zurufen, der einen Teil der Stadt in Asche legte. Die Feinde zogen nach Steinau weiter, das sie ebenfalls vergeblich belagerten. Am 27. März 1431 standen sie abermals vor Lüben, vermochten Ebenso, aber statt des Perlenrandes eine einfache Kreislinie. III. Sorte (586a): Wie 586, aber der Adler nach rechts sehend. Die beiden letzten Sorten dürften um 1450 geprägt worden sein. 118 Ebenda S. 73. 119 Cod. dipl. Siles. XIII Nr. 193; Zeichnung: Adlerschild. 120 Cod. dipl. Siles. XII S. 26. 121 In dem Lübener Taufregister wird noch um 1560 eine Münz- meisterin erwähnt. 122 cf. Grünhagen "Die Hussitenkämpfe der Schlesier" 1872 S. 152. Daß Ruprecht bei der ganzen Aktion nicht genannt wird, dürfte am leichtesten darin seine Erklärung finden, daß er in Ordensangelegen- heiten abwesend war. |
- 37 - aber auch jetzt nicht, die Stadt zu erobern123). Wiederum ging sie in Flammen auf. Ob die Feinde noch anderes Unheil ange- richtet haben, ist ungewiß. Mit Rücksicht auf "die swere vnd grosene verterbnis das se genomen entphangin vnd geleden habin von fewers noeth ober se hewer decz Jor irgangin vnd gescheen mit Namen in der czeith so se von den heren der vordamten vnd snoden (=schnöden) ketczer beranth vnd vmblegin vnd off das hoeste vorterbith woren", überließ Herzog Ludwig, der inzwischen Herr von Lüben geworden war, am 13. Oktober 1431 der Stadt das Stadtgericht mit allen Erträgen vorbehaltlich des dem Erb- vogt zustehenden dritten Pfennigs, dessen Erwerb jedoch dem Rate gestattet wurde124). Auch das Braugeld und 4 Gr. von dem Malz, das gebraut wurde, ward vielleicht damals der Stadt "zu einer sunderlichen Stewer vundt Hülffe zu Wiederaufrichtung vundt Besserung" verliehen, jedoch nicht als dauerndes Recht, sondern als eine vorübergehende Nutznießung125). Unter der Regierung Ludwigs III. begann sich die Liegnitzer Erbfolgefrage zuzuspitzen. Ludwig II. von Liegnitz starb am 30. April 1436. Wenn auch sein Fürstentum vorerst noch Leib- gedinge seiner Witwe blieb, so meldeten doch die Erbberechtigten alsbald ihre Ansprüche an. Kaiser Sigismund begehrte das Fürstentum als erledigtes Lehen126), und Ludwig III. von Lüben forderte die Mannschaft von Liegnitz zur Huldigung auf127). Letzterer scheint noch weitere Schritte getan zu haben, um seine Nachfolge in den Liegnitzer Landen sicher zu stellen; wenigstens hielt es König Albrecht für nötig, ihn zur Ruhe zu mahnen128). Er erlebte den Austrag des Streites nicht mehr. Der Tod raffte ihn im rüstigen Mannesalter im Jahre 1441 hinweg. Ihm folg- ten seine Söhne Johann und Heinrich in gemeinsamer Regierung ihrer Länder129). Sie wurde für die Stadt Lüben in mannigfacher 123 Scriptor. rer. Siles. XII, 49 Hussite fuerunt ante Lueben anno domini 1431 feria tertia post palmarum. Hussite obtinuerunt oppi- dum Lueben, sed non oppugnaverunt, licet illud per traditionem combusserunt. - Annales Glogovienses Band X: A. d. 1425 (muß heißen 1431) haeretici per vim obsederunt oppidum Lubin et ibi multos sacerdotes et scholares interfecerunt et magna damna fecerunt, demum totum oppidum excineraverunt et ab eo recesse- runt. Hier scheint eine Verwechslung mit Haynau vorzuliegen. Es bleibt unaufgeklärt, wie die Hussiten die Kleriker töten konnten, wenn sie die Stadt gar nicht eingenommen hatten. 124 Urkunden der Stadt Lüben Nr. 18 125 In der Urkunde vom 3.9.1498 (Urkunden der Stadt Lüben Nr. 32) wird die Verleihung dieser Gerechtigkeit auf den Stadtbrand zurückgeführt. Es könnte allerdings auch der von 1453 in Frage kommen. 126 25.5.1436 Lehnsurkunden I S. 382. 127 10.6.1436, ebenda S. 383. 128 12.7.1438, ebenda S. 390. 129 Beide Urkunden am 18.6.1441 über den Verkauf eines Vorwerks in Mallmitz; am 3.1.1443 über den Verkauf der Erb- vogtei; am 22.6.1444 über einen Vorwerksverkauf in Mallmitz; am 29.9.1445 über die Privilegienbestätigung. (Urkunden der Stadt Lüben |