


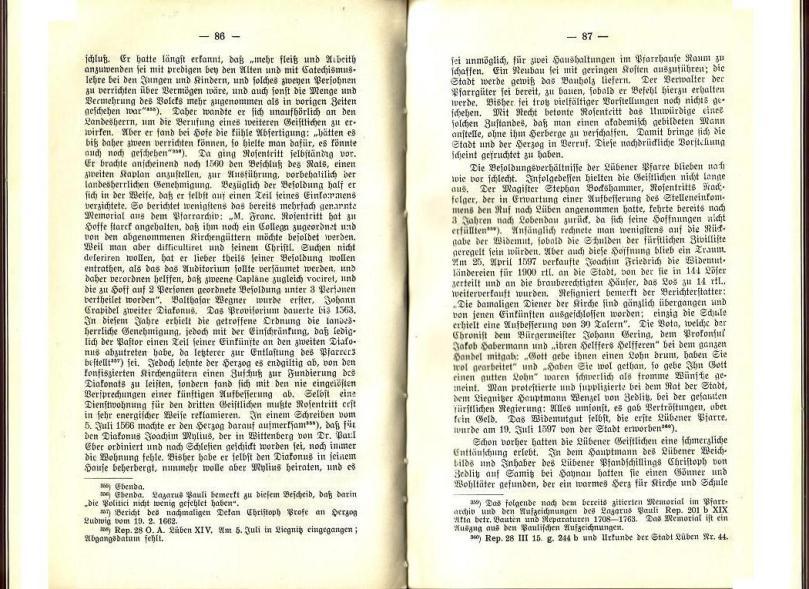
|
- 86 - schluß. Er hatte längst erkannt, daß "mehr fleiß und Arbeith anzuwenden sei mit predigen bey den Alten und mit Catechismus- lehre bei den Jungen und Kindern, und solches zweyen Persohnen zu verrichten über Vermögen wäre, und auch sonst die Menge und Vermehrung des Volckes mehr zugenommen als in vorigen Zeiten geschehen war"355). Daher wandte er sich unaufhörlich an den Landesherrn, um die Berufung eines weiteren Geistlichen zu er- wirken. Aber er fand bei Hofe die kühle Abfertigung: "hätten es biß daher zween verrichten können, so hielte man dafür, es könnte auch noch geschehen"356). Da ging Rosentritt selbständig vor. Er brachte anscheinend noch 1560 den Beschluß des Rats, einen zweiten Kaplan anzustellen, zur Ausführung, vorbehaltlich der landesherrlichen Genehmigung. Bezüglich der Besoldung half er sich in der Weise, daß er selbst auf einen Teil seines Einkommens verzichtete. So berichtet wenigstens das bereits mehrfach genannte Memorial aus dem Pfarrarchiv: "M. Franc. Rosentritt hat zu Hoffe starck angehalten, daß ihm noch ein Collega zugeordnet und von den abgenommenen Kirchengüttern möchte besoldet werden. Weil man aber difficultiret und seinem Christl. Suchen nicht deferiren wollen, hat er lieber theils seiner Besoldung wollen entrathen, als das das Auditorium sollte versäumet werden, und daher verordnen helffen, daß zweene Capläne zugleich vociret, und die zu Hoff auf 2 Personen geordnete Besoldung unter 3 Personen vertheilet worden". Balthasar Wegner wurde erster, Johann Crapidel zweiter Diakonus. Das Provisorium dauerte bis 1563. In diesem Jahr erhielt die getroffene Ordnung die landes- herrliche Genehmigung, jedoch mit der Einschränkung, daß ledig- lich der Pastor einen Teil seiner Einkünfte an den zweiten Diako- nus abzutreten habe, da letzterer zur Entlastung des Pfarrers bestellt357) sei. Jedoch lehnte der Herzog es endgiltig ab, von den konfiszierten Kirchengütern einen Zuschuß zur Fundierung des Diakonats zu leisten, sondern fand sich mit den nie eingelösten Versprechungen einer künftigen Aufbesserung ab. Selbst eine Dienstwohnung für den dritten Geistlichen mußte Rosentritt erst in sehr energischer Weise reklamieren. In einem Schreiben vom 5. Juli 1566 machte er den Herzog darauf aufmerksam358), daß für den Diakonus Joachim Mylius, der in Wittenberg von Dr. Paul Eber ordiniert und nach Schlesien geschickt worden sei, noch immer die Wohnung fehle. Bisher habe er selbst den Diakonus in seinem Hause beherbergt, nunmehr wolle aber Mylius heiraten, und es 355 Ebenda. 356 Ebenda. Lazarus Pauli bemerkt zu diesem Bescheid, daß darin "die Politici nicht wenig gefehlet haben". 357 Bericht des nachmaligen Dekan Christoph Profe an Herzog Ludwig vom 19.2.1662. 358 Rep. 28 O.A. Lüben XIV. Am 5. Juli in Liegnitz eingegangen; Abgangsdatum fehlt. |
- 87 - sei unmöglich, für zwei Haushaltungen im Pfarrhause Raum zu schaffen. Ein Neubau sei mit geringen Kosten auszuführen; die Stadt werde gewiß das Bauholz liefern. Der Verwalter der Pfarrgüter sei bereit, zu bauen, sobald er Befehl hierzu erhalten werde. Bisher sei trotz vielfältiger Vorstellungen noch nichts ge- schehen. Mit Recht betonte Rosentritt das Unwürdige eines solchen Zustandes, daß man einen akademisch gebildeten Mann anstelle, ohne ihm Herberge zu verschaffen. Damit bringe sich die Stadt und der Herzog in Verruf. Diese nachdrückliche Vorstellung scheint gefruchtet zu haben. Die Besoldungsverhältnisse der Lübener Pfarre blieben nach wie vor schlecht. Infolgedessen hielten die Geistlichen nicht lange aus. Der Magister Stephan Bockshammer, Rosentritts Nach- folger, der in Erwartung einer Aufbesserung des Stelleneinkom- mens den Ruf nach Lüben angenommen hatte, kehrte bereits nach 3 Jahren nach Lobendau zurück, da sich seine Hoffnungen nicht erfüllten359). Anfänglich rechnete man wenigstens auf die Rück- gabe der Widemut, sobald die Schulden der fürstlichen Zivilliste geregelt sein würden. Aber auch diese Hoffnung blieb ein Traum. Am 25. April 1597 verkaufte Joachim Friedrich die Widemut- ländereien für 1900 rtl. an die Stadt, von der sie in 144 Löser zerteilt und an die brauberechtigten Häuser, das Los zu 14 rtl., weiterverkauft wurden. Resigniert bemerkt der Berichterstatter: "Die damaligen Diener der Kirche sind gänzlich übergangen und von jenen Einkünften ausgeschlossen worden; einzig die Schule erhielt eine Aufbesserung von 30 Talern". Die Vota, welche der Chronist dem Bürgermeister Johann Gering, dem Prokonsul Jakob Habermann und "ihren Helffers Helfferen" bei dem ganzen Handel mitgab: "Gott gebe ihnen einen Lohn drum, haben Sie wol gearbeitet" und "Haben Sie wol gethan, so gebe Ihn Gott einen gutten Lohn" waren schwerlich als fromme Wünsche ge- meint. Man protestierte und supplizierte bei dem Rat der Stadt, dem Liegnitzer Hauptmann Wenzel von Zedlitz, bei der gesamten fürstlichen Regierung: Alles umsonst, es gab Vertröstungen, aber kein Geld. Das Widemutgut selbst, die erste Lübener Pfarre, wurde am 19. Juli 1597 von der Stadt erworben360). Schon vorher hatten die Lübener Geistlichen eine schmerzliche Enttäuschung erlebt. In dem Hauptmann des Lübener Weich- bilds und Inhaber des Lübener Pfandschillings Christoph von Zedlitz auf Samitz bei Haynau hatten sie einen Gönner und Wohltäter gefunden, der ein warmes Herz für Kirche und Schule 359 Das folgende nach dem bereits zitierten Memorial im Pfarr- archiv und den Aufzeichnungen des Lazarus Pauli Rep. 201 b XIX Akta betr. Bauten und Reparaturen 1708-1763. Das Memorial ist ein Auszug aus den Paulischen Aufzeichnungen. 360 Rep. 28 III 15. g. 244 b und Urkunde der Stadt Lüben Nr. 44 |