


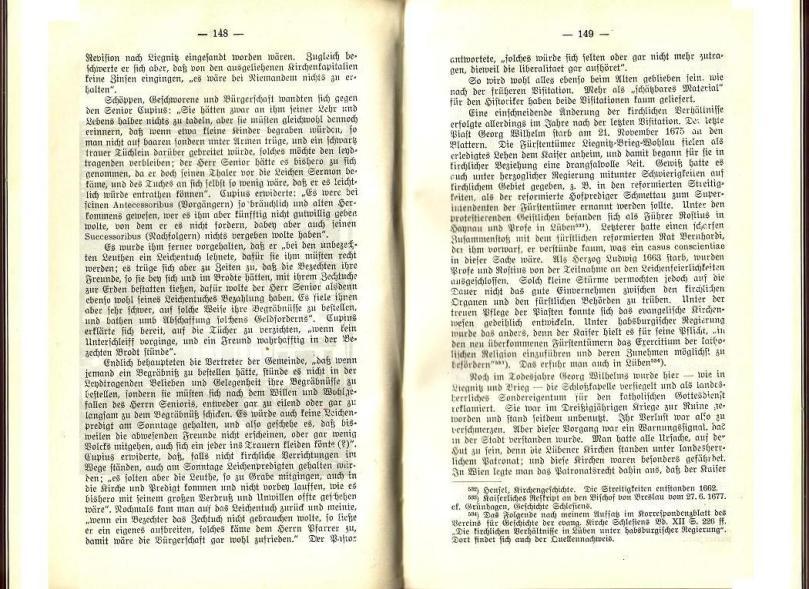
|
- 148 - Revision nach Liegnitz eingesandt worden wären. Zugleich be- schwerte er sich aber, daß von den ausgeliehenen Kirchenkapitalien keine Zinsen eingingen, "es wäre bei Niemandem nichts zu er- halten". Schöppen, Geschworene und Bürgerschaft wandten sich gegen den Senior Cupius: "Sie hätten zwar an ihm seiner Lehr und Lebens halber nichts zu tadeln, aber sie müsten gleichwohl dennoch erinnern, daß wenn etwa kleine Kinder begraben würden, so man nicht auf baaren sondern unter Armen trüge, und ein schwartz trauer Tüchlein darüber gebreitet würde, solches möchte den leyd- tragenden verbleiben; der Herr Senior hätte es bishero zu sich genommen, da er doch seinen Thaler vor die Leichen Sermon be- käme, und des Tuches an sich selbst so wenig wäre, daß er es leicht- lich würde entrathen können". Cupius erwiderte: "Es were bei seinen Antecessoribus (Vorgängern) so bräuchlich und alten Her- kommens gewesen, wer es ihm aber künfftig nicht gutwillig geben wolte, von dem er es nicht fordern, dabey aber auch seinen Successoribus (Nachfolgern) nichts vergeben wolte haben". Es wurde ihm ferner vorgehalten, daß er "bei den unbezech- ten Leuthen ein Leichentuch lehnete, dafür sie ihm müsten recht werden; es trüge sich aber zu Zeiten zu, daß die Bezechten ihre Freunde, so sie bey sich und im Brodte hätten, mit ihrem Zechtuche zur Erden bestatten ließen, dafür wolte der Herr Senior alsdenn ebenso wohl seines Leichentuches Bezahlung haben. Es fiele ihnen aber sehr schwer, auf solche Weise ihre Begräbnisse zu bestellen, und bathen umb Abschaffung solchen Geldforderns". Cupius erklärte sich bereit, auf die Tücher zu verzichten, "wenn kein Unterschleiff vorginge, und ein Freund wahrhafftig in der Be- zechten Brodt stünd". Endlich behaupteten die Vertreter der Gemeinde, "daß wenn jemand ein Begräbniß zu bestellen hätte, stünde es nicht in der Leydtragenden Belieben und Gelegenheit ihre Begräbnüsse zu bestellen, sondern sie müsten sich nach dem Willen und Wohlge- fallen des Herrn Senioris, entweder gar zu eilend oder gar zu langsam zu dem Begräbnüß schicken. Es würde auch keine Leichen- predigt am Sonntage gehalten, und also geschehe es, daß bis- weilen die abwesenden Freunde nicht erscheinen, oder gar wenig Volcks mitgehen, auch sich ein jeder ins Trauern kleiden könte (?)". Cupius erwiderte, daß, falls nicht kirchliche Verrichtungen im Wege ständen, auch am Sonntage Leichenpredigten gehalten wür- den: "es solten aber die Leuthe, so zu Grabe mitgingen, auch in die Kirche und Predigt kommen und nicht vorbey lauffen, wie es bishero mit seinem großen Verdruß und Unwillen offte geschehen wäre". Nochmals kam man auf das Leichentuch zurück und meinte, "wenn ein Bezechter das Zechtuch nicht gebrauchen wolte, so ließe er ein eigenes aufbreiten, solches käme dem Herrn Pfarrer zu, damit wäre die Bürgerschaft gar wohl zufrieden." Der Pastor |
- 149 - antwortete, "solches würde sich selten oder gar nicht mehr zutra- gen, dieweil die liberalitaet gar aufhöret". So wird wohl alles ebenso beim Alten geblieben sein, wie nach der früheren Visitation. Mehr als "schätzbares Material" für den Historiker haben beide Visitationen kaum geliefert. Eine einschneidende Veränderung der kirchlichen Verhältnisse erfolgte allerdings im Jahre nach der letzten Visitation. Der letzte Piast Georg Wilhelm starb am 21. November 1675 an den Blattern. Die Fürstentümer Liegnitz-Brieg-Wohlau fielen als erledigtes Lehen dem Kaiser anheim, und damit begann für sie in kirchlicher Beziehung eine drangsalvolle Zeit. Gewiß hatte es auch unter herzoglicher Regierung mitunter Schwierigkeiten auf kirchlichem Gebiet gegeben, z. B. in den reformierten Streitig- keiten, als der reformierte Hofprediger Schmettau zum Super- intendenten der Fürstentümer ernannt werden sollte. Unter den protestierenden Geistlichen befanden sich als Führer Rostius in Haynau und Profe in Lüben532). Letzterer hatte einen scharfen Zusammenstoß mit dem fürstlichen reformierten Rat Bernhardi, der ihm vorwarf, er verstünde kaum, was ein casus conscientiae in dieser Sache wäre. Als Herzog Ludwig 1663 starb, wurden Profe und Rostius von der Teilnahme an den Leichenfeierlichkeiten ausgeschlossen. Solch kleine Stürme vermochten jedoch auf die Dauer nicht das gute Einvernehmen zwischen den kirchlichen Organen und den fürstlichen Behörden zu trüben. Unter der treuen Pflege der Piasten konnte sich das evangelische Kirchen- wesen gedeihlich entwickeln. Unter habsburgischer Regierung wurde das anders, denn der Kaiser hielt es für seine Pflicht, "in den neu überkommenen Fürstentümern das Exercitium der katho- lischen Religion einzuführen und deren Zunehmen möglichst zu befördern533). Das erfuhr man auch in Lüben534). Noch im Todesjahre Georg Wilhelms wurde hier - wie in Liegnitz und Brieg - die Schloßkapelle versiegelt und als landes- herrliches Sondereigentum für den katholischen Gottesdienst reklamiert. Sie war im Dreißigjährigen Kriege zur Ruine ge- worden und stand seitdem ungenutzt. Ihr Verlust war also zu verschmerzen. Aber dieser Vorgang war ein Warnungssignal, das in der Stadt verstanden wurde. Man hatte alle Ursache, auf der Hut zu sein, denn die Lübener Kirchen standen unter landesherr- lichem Patronat; und diese Kirchen waren besonders gefährdet. In Wien legte man das Patronatsrecht dahin aus, daß der Kaiser 532 Hensel, Kirchengeschichte. Die Streitigkeiten entstanden 1662. 533 Kaiserliches Reskript an den Bischof von Breslau vom 27.6.1677. cf. Grünhagen, Geschichte Schlesiens. 534 Das Folgende nach meinem Aufsatz im Korrespondenzblatt des Vereins für Geschichte der evang. Kirche Schlesiens Bd. XII S. 226 ff. "Die kirchlichen Verhältnisse in Lüben unter habsburgischer Regierung". Dort findet sich auch der Quellennachweis. |