


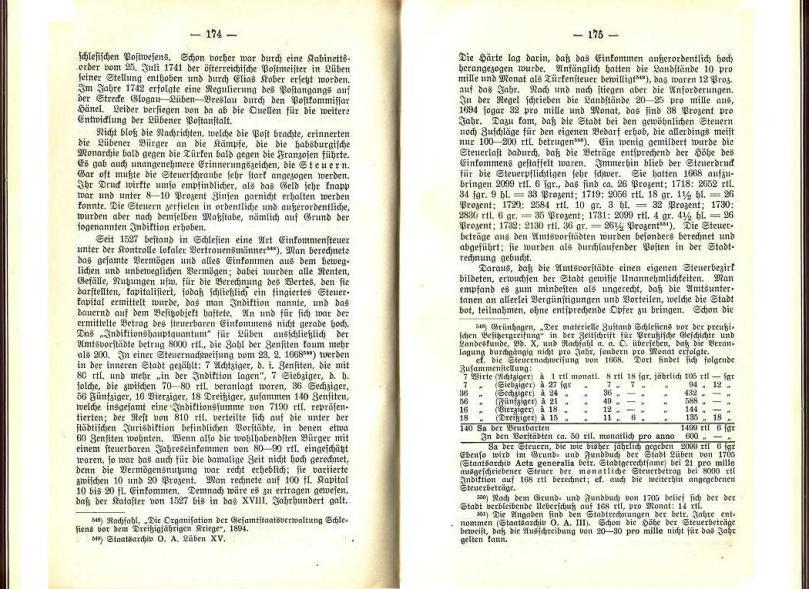
|
- 174 - schlesischen Postwesens. Schon vorher war durch eine Kabinetts- order vom 25. Juli 1741 der österreichische Postmeister in Lüben seiner Stellung enthoben und durch Elias Kober ersetzt worden. Im Jahre 1742 erfolgte eine Regulierung des Postangangs auf der Strecke Glogau-Lüben-Breslau durch den Postkommissar Hänel. Leider versiegen von da ab die Quellen für die weitere Entwicklung der Lübener Postanstalt. Nicht bloß die Nachrichten, welche die Post brachte, erinnerten die Lübener Bürger an die Kämpfe, die die habsburgische Monarchie bald gegen die Türken bald gegen die Franzosen führte. Es gab auch unangenehmere Erinnerungszeichen, die Steuern. Gar oft mußte die Steuerschraube sehr stark angezogen werden. Ihr Druck wirkte umso empfindlicher, als das Geld sehr knapp war und unter 8-10 Prozent Zinsen garnicht erhalten werden konnte. Die Steuern zerfielen in ordentliche und außerordentliche, wurden aber nach demselben Maßstabe, nämlich auf Grund der sogenannten Indiktion erhoben. Seit 1527 bestand in Schlesien eine Art Einkommenssteuer unter der Kontrolle lokaler Vertrauensmänner548). Man berechnete das gesamte Vermögen und alles Einkommen aus dem beweg- lichen und unbeweglichen Vermögen; dabei wurden alle Renten, Gefälle, Nutzungen usw. für die Berechnung des Wertes, den sie darstellten, kapitalisiert, sodaß schließlich ein fingiertes Steuer- kapital ermittelt wurde, das man Indiktion nannte, und das dauernd auf dem Besitzobjekt haftete. An und für sich war der ermittelte Betrag des steuerbaren Einkommens nicht gerade hoch. Das "Indiktionshauptquantum" für Lüben ausschließlich der Amtsvorstädte betrug 8000 rtl., die Zahl der Zensiten kaum mehr als 200. In einer Steuernachweisung vom 23.2.1668549) werden in der inneren Stadt gezählt: 7 Achtziger, d. i. Zensiten, die mit 80 rtl. und mehr "in der Indiktion lagen", 7 Siebziger, d. h. solche, die zwischen 70-80 rtl. veranlagt waren, 36 Sechziger, 56 Fünfziger, 16 Vierziger, 18 Dreißiger, zusammen 140 Zensiten, welche insgesamt eine Indiktionssumme von 7190 rtl. repräsen- tierten; der Rest von 810 rtl. verteilte sich auf die unter der städtischen Jurisdiktion befindlichen Vorstädte, in denen etwa 60 Zensiten vohnten. Wenn also die wohlhabendsten Bürger mit einem steuerbaren Jahreseinkommen von 80-90 rtl. eingeschätzt waren, so war das auch für die damalige Zeit nicht hoch gerechnet, denn die Vermögensnutzung war recht erheblich; sie variierte zwischen 10 und 20 Prozent. Man rechnete auf 100 fl. Kapital 10 bis 20 fl. Einkommen. Demnach wäre es zu ertragen gewesen, daß der Kataster von 1527 bis in das XVIII. Jahrhundert galt. 548 Rachfahl, "Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung Schle- siens vor dem Dreißigjährigen Kriege", 1894. 549 Staatsarchiv O. A. Lüben XV. |
- 175 - Die Härte lag darin, daß das Einkommen außerordentlich hoch herangezogen wurde. Anfänglich hatten die Landstände 10 pro mille und Monat als Türkensteuer bewilligt549), das waren 12 Proz. auf das Jahr. Nach und nach stiegen aber die Anforderungen. In der Regel schrieben die Landstände 20-25 pro mille aus, 1694 sogar 32 pro mille und Monat, das sind 38 Prozent pro Jahr. Dazu kam, daß die Stadt bei den gewöhnlichen Steuern noch Zuschläge für den eigenen Bedarf erhob, die allerdings meist nur 100-200 rtl. betrugen550). Ein wenig gemildert wurde die Steuerlast dadurch, daß die Beträge entsprechend der Höhe des Einkommens gestaffelt waren. Immerhin blieb der Steuerdruck für die Steuerpflichtigen sehr schwer. Sie hatten 1668 aufzu- bringen 2099 rtl. 6 sgr., das sind ca. 26 Prozent; 1718: 2652 rtl. 34 sgr. 9 hl. = 33 Prozent; 1719: 2056 rtl. 18 gr. 1 1/2 hl. = 26 Prozent; 1720: 2584 rtl. 10 gr. 3 hl. = 32 Prozent; 1730: 2830 rtl. 6 gr. = 35 Prozent; 1731: 2099 rtl. 4 gr. 4 1/2 hl. = 26 Prozent; 1732: 2130 rtl. 36 gr. = 26 1/2 Prozent551). Die Steuer- beträge aus den Amtsvorstädten wurden besonders berechnet und abgeführt; sie wurden als durchlaufender Posten in der Stadt- rechnung gebucht. Daraus, daß die Amtsvorstädte einen eigenen Steuerbezirk bildeten, erwuchsen der Stadt gewisse Unannehmlichkeiten. Man empfand es zum mindesten als ungerecht, daß die Amtsunter- tanen an allerlei Vergünstigungen und Vorteilen, welche die Stadt bot, teilnahmen, ohne entsprechende Opfer zu bringen. Schon die 549 Grünhagen, "Der materielle Zustand Schlesiens vor der preußi- schen Besitzergreifung" in der Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde, Bd. X, und Rachfahl a. a. O. übersehen, daß die Veran- lagung durchgängig nicht pro Jahr, sondern pro Monat erfolgte. cf. die Steuernachweisung von 1668. Dort findet sich folgende Zusammenstellung:
(Staatsarchiv Acta generalia betr. Stadtgerechtsame) bei 21 pro mille ausgeschriebener Steuer der m o n a t l i c h e Steuerbetrag bei 8000 rtl Indiktion auf 168 rtl berechnet; cf. auch die weiterhin angegebenen Steuerbeträge. 550 Nach dem Grund- und Fundbuch von 1705 belief sich der der Stadt verbleibende Ueberschuß auf 168 rtl, pro Monat: 14 rtl. 551 Die Angaben sind den Stadtrechnungen der betr. Jahre ent- nommen (Staatsarchiv O. A. III). Schon die Höhe der Steuerbeträge beweist, daß die Ausschreibung von 20-30 pro mille nicht für das Jahr gelten kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||