
Manfred Bürger (1930-2010) |
Wie ein Vierzehnjähriger die letzten Tage in Lüben erlebte
Eisig fegte der Schneesturm über die bereits dick verwehte Landstraße im niederschlesischen Flachland, als sich am 29. Januar 1945 ein Wehrmachts-LKW mit uns Flüchtlingen aus der noch nahen Kleinstadt mühselig zum nächsten größeren Ort durchkämpfte. Unter einer naßkalten Gummiplane geduckt, saßen wir - etwa zwanzig zufällig zusammengewürfelte Menschen aller Altersstufen, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und ich - eng aneinander gedrängt auf den harten Pritschen und der feuchten Ladefläche des Fahrzeugs und versuchten, uns vor dem durchdringenden Sturm und dem kalten Schnee notdürftig zu schützen. Immer wieder blieb der LKW in den schnell wachsenden Schneemassen stecken, wenn er seitlich aus der noch einigermaßen freien Fahrspur in der Straßenmitte einem eilig entgegenkommenden Militärfahrzeug mit Soldaten oder Munition oder einem Sanitätswagen ausweichen mußte. Dann hieß es runter vom Auto, anschieben und während der anfangs langsamen rutschenden Fahrt wieder aufsitzen. Immer wieder orgelten Geschützsalven über unsere Köpfe hinweg und ließen mehr oder weniger entfernt unter grollendem Donner die Erdfontänen hochsteigen. Es galt, keinen Gedanken daran zu verschwenden, daß eine dieser Granaten gezielt oder zufällig auch unseren LKW treffen und uns alle gemeinsam ins Jenseits befördern konnte. Hatte man doch gewarnt, daß auch diese letzte offene Verbindung westwärts bereits unter Feindeinsicht liege. Seit Tagen schon zog das Leben unwirklich, gespenstisch an uns vorüber. Es berührte uns nicht mehr real. Wie in einem Film betrachteten wir das Geschehen um uns und mit uns. Wir standen gewissermaßen lediglich beobachtend neben uns selbst. Ein Schutzinstinkt? Unvermögen, die Realität richtig einschätzen zu können? Fatalismus? Oder einfach die Tatsachen nicht wahrhaben, nicht zur Kenntnis nehmen wollen? Links und rechts des Weges sahen wir hin und wieder im Straßengraben liegengebliebene Fahrzeuge, aber auch leer geräumte oder noch vollgepackte Fuhrwerke, Handwagen, Fahrräder oder Schlitten, die von den schon seit Tagen vor uns diesen Weg entlang gezogenen Flüchtlingen, schlappmachend im Stich gelassen werden mußten. |
|
 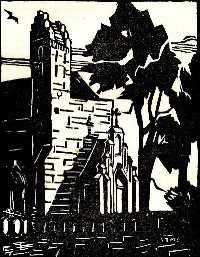 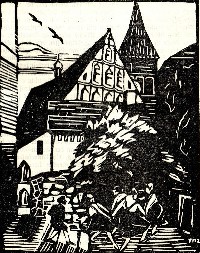                     |
Plötzlich wurden wir aus unserem fatalistischen Dämmerzustand aufgeschreckt. Ein durch Mark und Bein dringendes, immer lauter werdendes Dröhnen ließ uns die deckende Plane vergessen und ratlos ins schmerzende Weiß der eintönigen Umgebung blicken. Der entsetzte Ruf "Flugzeugangriff!" brachte in Bruchteilen von Sekunden eine wie Heringe in der Dose geschichtete Masse Mensch auf dem Fahrzeugboden zustande. Da war eine Maschine auch schon in gefährlich geringer Höhe über uns hinweggedonnert. Aber keine todbringende Bombenexplosion, kein Rattern eines Maschinengewehrs, noch fuhr unser Fahrzeug in unsicherer Schlangenlinie dahin, nach Sekunden erst riß uns ein ungeheurer Donnerschlag vom Boden hoch. Keinen Kilometer von uns entfernt, hatte sich die Maschine explodierend in den Ackerboden gebohrt, einen riesigen schwarzen Qualmpilz aufsteigen lassend. Irgend jemand auf unserem Wagen hatte am Balkenkreuz eine unserer Maschinen erkannt und auch die dicke Rauchfahne aus dem abschmierenden Flugzeug bemerkt. Wieder einmal davongekommen! Kein Gedanke mehr an die sich eben vor unseren Augen abspielende Tragödie. Wie viele Menschen mögen im Flugzeug umgekommen sein? Waren es viele oder wenige? Einer mehr oder weniger - was spielte es in diesem mörderischen, wahnsinnigen Krieg noch für eine Rolle? Wer zählte noch die unsinnigen Toten? Ohne anzuhalten, setzte der LKW seine Fahrt mit uns fort. Die letzten Tage davor waren wie in einem Alptraum an uns vorübergezogen, ohne daß sich auch nur einer von uns über die wahren Ausmaße des Geschehens im geringsten klar geworden wäre. Mein Vater, Sanitätsunteroffizier der deutschen Luftwaffe, hatte eine Woche zuvor gerade seinen Genesungsurlaub in unserer kleinen alten Lindenstadt beendet und erhielt Befehl, sich zum direkten Fronteinsatz sofort in der Dragonerkaserne zu melden. In Deutschland herrschte bereits seit einigen Monaten der "totale Krieg"! Von diesem Zeitpunkt an erfuhren wir lange nichts mehr von ihm. Schon im September 1944 war der Volkssturm - gleichsam das letzte Aufgebot an alten Männern, Gebrechlichen, Kranken, Verwundeten, Kindern und sogar jungen Frauen aufgestellt worden, um "die Heimat mit allen Mitteln bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen", häufig genug ohne Waffen und Munition zu besitzen. Die Gerüchte über Wunderwaffen Hitlers überstürzten sich. Waffen, wie die gegen England bereits mehrfach abgefeuerten V2-Raketen, die den schnellen Umschwung der Kriegshandlungen herbeiführen und den Endsieg garantieren sollten. Wer aber glaubte noch daran? Die Russen hatten bereits die östlichen Grenzen Schlesiens an der Oder überschritten. Die Lage an der Ostfront war - wie generell - niederschmetternd: Ein " erfolgreicher Rückzug" nach dem anderen stellte sich in der Realität mehr oder weniger als chaotische Flucht aller Heeresverbände heraus. Eine angriffsfähige Luftwaffe existierte schon lange nicht mehr. Tag und Nacht strömten Tausende und Abertausende Flüchtlinge aus den östlicher gelegenen Gebieten durch unser kleines verträumtes Städtchen... Am Bahnhof trafen Zug um Zug die trostlosen Menschenmassen ein. Auf dem sonst stillen Marktplatz rumpelte Wagen um Wagen, Treck auf Treck übers Kopfsteinpflaster. Kaum waren noch Verpflegung und die Versorgung der Kranken aufrecht zu erhalten. Schon wochenlang waren viele dieser Menschen, vor allem Frauen und Kinder in den seit Tagen wütenden Schneestürmen unterwegs. Viele besaßen nur mehr das, was sie gerade auf dem Körper trugen. Kälte und Chaos, Krankheit und Hunger forderten ihren Tribut. Steifgefrorene Leichen wurden von den meist völlig überladenen Wagen heruntergehoben und wie Holzstapel auf dem Platz vor dem Rathaus aufgeschichtet. Bald schon wurde nicht mehr gezählt, die Identität nicht mehr festgestellt. Wen interessierte dieses immer größer werdende Elend noch? Immer stärker trat uns vor Augen, daß es für uns selbst nur noch ums nackte Überleben ging. An einem dieser letzten Tage standen wir in der Abenddämmerung auf dem Hof in der Kasernenstraße 2 und sahen im Südosten am Horizont den Himmel erglühen. Ununterbrochen grollte der ferne Donner und unzählige Blitze zerrissen den geröteten Himmel. Die sogenannte "Abwehrschlacht der Festung Breslau" war in vollem Gange. Wie sich später herausstellte, war es das Angriffsfeuer der Russen, die nach mehrfach unbeantwortet gebliebenen Ultimaten, die Geschütze und Katjuschas sprechen ließen. Bis zum 6. Mai wurde die Festungsstadt von den Soldaten auf Befehl der braunen Parteibonzen und der SS "verteidigt". Tausende starben noch einen sinnlosen Tod und 70% Breslaus sanken in Trümmer. Wir begannen die Koffer mit dem Nötigsten zu packen. Was aber war das Nötigste? Warme Kleidung für einige Tage außerhalb der unmittelbaren Gefahrenzone bis zur Rückkehr? Dokumente und Wertsachen, um diese vor unerlaubtem Zugriff während unserer möglicherweise tagelang währenden Abwesenheit zu retten? Niemand sagte es uns, und wir hatten so etwas nie geprobt. Wußten es vielleicht die Millionen anderer Menschen, die gleiches Schicksal erdulden mußten? Hatten es die Millionen Toten zuvor je erfahren? Unsere Welt brach aus den Angeln! Warum wir? Was hatten wir mit dem furchtbaren Krieg zu tun? Wir hatten ihn nicht gewollt, nicht befürwortet, nicht geführt! Nun sollten auch wir - unschuldig wie wir uns fühlten - darunter leiden? Am 26. Januar hatte der Kreisleiter der Nazipartei (So hätten wir es uns dazumal nie getraut laut zu sagen!) auf dem verschneiten Marktplatz zu den Menschen dieser Stadt gesprochen. Wir hörten über den noch recht gut funktionierenden "Buschfunk" aus der Nachbarschaft davon. Außer dem üblichen, schon nicht mehr anhörbaren "Endsieg-Geschwafel", den ständig wiederholten Durchhalte-Parolen an die "heldenhaften Landser" in ihrem unermüdlichen Abwehrkampf gegen die "Roten Horden", wurde bekanntgegeben, daß auch unsere Stadt zur strategisch wichtigen Festung erklärt wurde und binnen 3 Tagen von der gesamten Bevölkerung zu räumen sei. Ein Witz der Weltgeschichte! Diese Kleinstadt - eine strategisch wichtige Festung! Ja - waren die alle schon völlig verrückt geworden? Von der Bann-Dienststelle der Hitlerjugend kam der Befehl für alle Angehörigen der HJ zum sofortigen Antreten in voller Winteruniform auf dem Schulhof. Der Bannführer hielt die übliche Rede und forderte unseren vollen Einsatz beim Volkssturm, um den Feind endgültig zurückzuschlagen. Versierte Skifahrer sollten vortreten. Mein Zugführer stieß mich an, - und wohl instinktiv trat ich mit ihm gemeinsam vor. Wir waren etwa 10 Mann, die als Meldegänger eingesetzt werden sollten. Alle anderen marschierten ab zum Waffen fassen. Von ihnen, den Gefährten meiner Jugend, den Nachbarskindern, den Schulfreunden und Mitpimpfen sollte kaum einer mehr zurückkehren. Nur wenige tauchten in späteren Jahren mal hier und da wieder auf. Wir aber sollten nach Hause und uns in 20 Minuten mit Skiausrüstung im Bann wieder zum Einsatz melden. Gesagt - getan! Dort erhielten wir dann Schriftstücke, die zum Hauptpostgebäude, dem Sitz der HKL - der Hauptkampflinien-Leitzentrale der deutschen Wehrmacht - zu bringen waren. Hier erlebte ich nun meine "erste Feindberührung". Zwei eben gefangengenommene Russen wurden zum Verhör gebracht. Ein vollbärtiger alter Mann, dem anstelle der rechten Hand nur ein gefrorener blutiger Stummel geblieben war, und ein verstörter Junge von kaum 15 Jahren in völlig zerrissener Kleidung standen, vor Kälte und sicherlich noch mehr vor Todesangst zitternd, neben ihrem Bewacher. Das sollten die furchtbaren Feinde sein, vor denen sich die "bestausgerüstete Armee der Welt" in voller Flucht befand? Zweifel über Zweifel nisteten sich tagtäglich mehr in meinem Hirn ein. Und ich selbst - ich war ja noch nicht einmal 15 Jahre - und schon im "Kampfeinsatz". Unser sogenannter Volkssturm war ja auch nur ein letztes verzweifeltes Aufgebot. Keine ausgebildeten Kämpfer, keine Bewaffnung, ja nicht einmal eine der Witterung angepaßte Kleidung. Aber zum Nachdenken blieb damals keine Zeit. Mein Kumpel meinte auf dem Rückweg zum Bann, daß es wohl höchste Zeit wäre in diesem Chaos nach Hause zu verschwinden, die Uniform auszuziehen und im Verborgenen abzuwarten. So wurden wir "fahnenflüchtig", ohne je Soldat gewesen zu sein. Später, sehr viel später würde man "von der Gnade der späten Geburt" sprechen! Am nächsten Morgen, fünf Uhr in der Frühe, sollte ein erster Trecker - Konvoi vom Kino "Capitol" ab mit Flüchtlingen die Heimatstadt verlassen. Schon eine Stunde früher marschierten wir in klirrender Kälte los und standen mit unzähligen anderen Stadtbewohnern Stunde um Stunde und warteten vergeblich. Spät am Vormittag teilte man dann den frierenden Wartenden mit, daß erst am nächsten Tag gegen 11 Uhr mit Fahrzeugen zu rechnen sei. So scheiterte ein erster befohlener Versuch. Über Nacht hatte es erneut etwa 30 cm Neuschnee gegeben. Am Vormittag - es war inzwischen der 27. Januar - wieder hin zum Kino. Durch die zahllosen Trecks, die durch unser Städtchen zogen, die zurückflutenden Armeekolonnen und die Nachschub bringenden Wehrmachtsfahrzeuge war der auf den Straßen und Wegen hochliegende Schnee zerwühlt und an ein Fortkommen mit Schlitten oder Handwagen nicht zu denken. Wir schleppten daher nur wenige Gepäckstücke mit uns. Doch infolge dieser Schneeverhältnisse wurde wieder kein Fahrzeug gestellt. Man leitete die Menschen kurzerhand zum Bahnhof um, wo angeblich Sonderzüge in Richtung Westen fahren sollten. Die Front war über Nacht wieder näher gerückt. Der Geschützdonner hörte sich gefährlich lauter und drohender an, die nervöse Unruhe der Soldaten war offensichtlicher, die umherziehende Einwohnerschaft schien ratloser und zielloser. Auch Mutter wußte natürlich nicht, was richtig sei in dieser Situation. Warten, umkehren oder wie die meisten anderen auch zum Bahnhoflaufen? Schließlich sollte ich schnell nach Hause und doch noch den Schlitten holen. Unterwegs auf dem höchstens zehnminütigen Heimweg fielen mir hier und da Soldaten im weißen Tarnanzug mit schußbereiter Waffe im Arm auf. Das ließ den Schluß zu, daß unsere Stadt bereits zum unmittelbaren Frontbereich gehörte. Dann, an der Evangelischen Kirche angelangt, krachte plötzlich eine Granate ins hohe steile Kirchendach. Ich preßte mich geduckt dicht ans Mauerwerk. Dachziegel fielen neben mir zerplatzend zu Boden. Ein ebenfalls Deckung suchender Soldat gab mir den sicher wohlmeinenden Ratschlag, besser daheim zu bleiben. Den Rest des Weges legte ich atemlos rennend zurück, und gleich ging es mit dem kleinen Kinderschlitten wieder retour. Das Schlimmste wäre doch in dieser Situation, von den Familienangehörigen getrennt zu werden. Da lediglich 2 der 4 Gepäckstücke auf den Schlitten paßten, transportierten wir das Gepäck etappenweise wechselnd. Immer voller Angst, den letzten Zug zu verpassen. Der Bahnhof und die schmalen Bahnsteige waren total mit Menschen verstopft. Falls überhaupt, sollte der Zug auf Gleis 2 bereitgestellt werden. Auf Gleis l fuhr inzwischen ein Lazarettzug ein. Unzählige Tragbahren mit schwerverwundeten Soldaten wurden aus vorgefahrenen Sanitätskraftwagen in den Zug umgeladen. Es sah furchtbar aus! Ein weiteres Schreckensbild des sehr nahen Krieges! Wir hatten inzwischen das Gepäck auf dem Bahnsteig inmitten der wartenden Menschenmenge abgestellt und den Schlitten hinter einem Schuppen verborgen. Unter den verzweifelt ausharrenden Menschen schwirrten Gerüchte verschiedenster Art umher. Die Russen seien bereits an der Stadtgrenze, die Wehrmacht auf der Flucht aus dem Stadtbereich, die Verluste riesengroß, die Gleisverbindungen unterbrochen, die Stadt völlig eingekesselt, der nahegelegene Militärflughafen bereits in Feindeshand, die Stadtoberhäupter und "Goldfasanen" (so wurden die Nazibonzen nach ihren braunen Phantasieuniformen heimlich bezeichnet!) in Sicherheit gebracht, die völlig verunsicherte Bevölkerung aufgegeben! Gerüchte! Gerüchte ??? Wenigstens glauben wollte man, daß daran nichts, aber auch gar nichts Wahres war. Eine Lautsprecherstimme gab schließlich bekannt, daß frühestens am Nachmittag ein Zug eingesetzt werden könnte. So beschloß Mutter, Bruder Hans am Bahnhof beim Gepäck zurückzulassen und mit dem Rest der Familie zu einem schnell zubereiteten Mittagessen heimzugehen. Ich löste dann Brüderchen ab, und nach eineinhalb Stunden warteten wir wieder vereint auf dem Bahnsteig. Nur unser Schlitten war inzwischen abhanden gekommen. So hatte Mutter den schwereren Handwagen mitgebracht, falls wir einmal mehr umkehren mußten. Auch am Nachmittag kam kein Zug. Allmählich setzte sich die bittere Erkenntnis durch, daß an all diesen Gerüchten vielleicht doch etwas Wahres sein könnte. Wieder mußte mein elfjähriger Bruder die erste "Wachschicht" am zurückbleibenden reduzierten Gepäck übernehmen, während wir 2 Koffer mit dem Handwagen nach Hause zurückfuhren. Nach improvisiertem Abendessen legten meine Schwester und ich uns angekleidet zum Schlafen, während Mutter wieder zum Bahnhof lief. Ich konnte nicht einschlafen. Die Gedanken mühten sich um Klarheit. Was sollte werden? Eine unheimliche Explosion ließ mich hochfahren. Die Türen im Haus sprangen auf, Putz fiel von Wänden und Decke, die Möbel schwankten. Und dann - Schlag auf Schlag! Die russische Artillerie! Plötzlich war auch der Strom weg. Die Lichter der Stadt gingen auch in den Stuben aus - und blieben es - für immer! Dem unheimlichen Pfeifen der heranfliegenden Granaten folgte das Krachen des Einschlags. Viele Geschütze mußten es sein, die dieses teuflisches Konzert für eine kleine niederschlesische Stadt angestimmt hatten. Als der Beschuß ein wenig nachließ, holte uns Mutter zum nächtlichen Bahnhof. Wir wollten unbedingt zusammen sein. Wieder standen wir unter den noch immer dichtgedrängten Massen auf Bahnsteig 2. Je länger wir ausharrten, um so stärker spürten wir die Kälte an uns aufsteigen. Müdigkeit und Hunger, Zweifel und Ungewißheit trugen das ihre zum Kräfteverfall bei. Der neue Tag war längst heraufgezogen. Er brachte neue Kälte - die Ungewißheit blieb! Dann am späten Vormittag eine Durchsage: "Vorsicht auf Gleis 2. Durchfahrt eines Güterzuges!" Sollte das ein Zug für uns sein? Aufgepaßt,- da rollte er schon heran. Und plötzlich wurde unser großer Koffer vom Trittbrett des l .Wagens mitgerissen. Mutter versuchte ihn zu erwischen, rutschte aus, fiel hin. Unsere 6 Hände hatten sich blitzschnell in ihre Kleidung verkrallt und hielten krampfhaft fest. Mit panisch aufgerissenen Augen blickte ich auf die nur Zentimeter vor den Schuhsohlen von Mutter vorüberrollenden schweren Eisenräder. Der vereiste Boden unter unseren Schuhen wurde glatt und glätter und nur ein winziger Rutscher unsererseits und es würde geschehen. Es währte schier eine Ewigkeit bis der Zug endlich vorüber war und Mutter sich totenbleich wieder erheben konnte. Uns allen zitterten die Knie und das Entsetzen und die Angst standen uns deutlich ins Gesicht geschrieben. Was wäre, wenn ... ? Nur nicht zu Ende denken! Während wir unser Gepäck wieder zusammensuchten, setzte erneut heftiger Artillerie-Beschuß ein. Plötzlich eine ohrenbetäubende Explosion, ein Beben der Erde, und langsam färbte sich der Himmel im Norden der Stadt schmutzig blutrot. Wie wir wenig später von Soldaten hörten, hatten die "Unsrigen" den Flugplatz in die Luft gejagt. "Verbrannte Erde" nannte man dieses grauenvolle Verfahren, dem vorrückenden Feind nichts mehr in die Hände fallen zu lassen. So wurde es allüberall gehandhabt, - auch im fernsten Rußland hatte man nicht anders gehandelt, wie wir erst Jahre später erfuhren. Kein Bauwerk von Menschenhand durfte stehen bleiben. Alles wurde dem Erdboden gleichgemacht, bevor man das Weite suchte. Kurz nach dem entsetzlichen Knall kam ein aufgeregter Bahnbeamter auf den Bahnsteig gerannt und rief:" Alles weg vom Bahnhof und nach Hause. Die Russen sind in der Stadt!" Panik brach aus! Kreischen, Heulen, Schreie, - jeder stürzte über jeden, alles rannte zum viel zu engen Ausgang. Das weggeworfene Gepäck türmte sich blitzschnell zu schier unüberwindlichen Barrieren. Zäune wurden eingedrückt, Türen aus den Angeln gehoben, Fensterglas ging klirrend zu Bruch. Die Menschen ertraten sich gegenseitig, die um sich schlagenden Knäuel schienen unentwirrbar. Wir vier waren - zum Glück - ratlos und verwirrt erstarrt. Dann stellten wir unsere 2 kleinen Koffer einfach in eine Ecke, sie würden zwischen den hunderten umherliegenden Gepäckstücken aller Art ohnehin nicht auffallen. Als sich das Bahnhofsgebäude dann doch allmählich leerte, verließen auch wir die zugige winterkalte Halle. Nur wenige Meter entfernt warfen wir aus Schwäche auch die beiden größeren Koffer über einen Grundstückszaun in einen der tief verschneiten Vorgärten. Dann ging es so schnell uns die Füße tragen konnten heimwärts. Die Haustür war noch nicht ganz geschlossen, da setzte der Artilleriebeschuß wieder heftig ein, die Einschläge diesmal in nächster Nähe. Nun war auch bedrohlich nahe Gewehr- und Maschinengewehrfeuer zu vernehmen. Die darauffolgende Nacht, vom Geknatter der Handfeuerwaffen, vom Geschützdonner und Panzerkettengeklirr zerhämmert verbrachten wir gemeinsam mit unserer "Einquartierung" in einem Zimmer. Seit einiger Zeit nämlich war eine weißrussische Familie bei uns eingewiesen, - ein bei der kulturellen Truppenbetreuung eingesetzter Ballettmeister und seine Frau, Primaballerina an der Lemberger Oper, mit ihrem siebenjährigen Sohn. Viel später erst - und viel zu spät - machten wir uns Gedanken, was wohl diese Menschen in diesen für sie verhängnisvollen Tagen bewegt haben mochte? Sie hatten ja den sicheren Tod vor Augen! Wir konnten vielleicht mit ein wenig Glück immer noch entkommen! Mit dem heraufziehenden Tag, - es war Sonntag, der 28. Januar 1945 - kehrte allmählich wieder Ruhe ein. Mutter öffnete vorsichtig die Haustür einen Spalt breit und schreckte im selben Augenblick zurück, die Tür gleich wieder zuschlagend. Lauter Galopp von Pferden hämmerte über das Katzenkopfpflaster unserer Straße. Mißtrauisch durch die Gardinen lugend, erblickten wir seltsame, in unbekannte Uniformen gekleidete Reitergestalten mit hohen schwarzen Pelzmützen. Eine ganze Schwadron galoppierte vorüber. Russen! Die Russen sind da! Aber als im selben Moment unsre Soldaten im weißen Tarnumhang gleichen Weges zogen, konnte doch irgend etwas an unserer Beobachtung nicht stimmen? Wir wagten einen der Soldaten zu fragen. Das seien weißrussische Kosaken, die "auf unserer Seite" kämpften. Wir hatten ja Russen erwartet, - das aber waren andere Russen! Eigenartig und verwirrend erschien uns die Realität. Wir erfuhren weiter, daß nachts die Feinde die Stadt bereits erobert, sich frühmorgens aber unerklärlicherweise wieder zurückgezogen hatten. Langsam tauchten auch die Nachbarn aus ihren nächtlichen Verstecken wieder auf. Welch Trost, daß wir nicht, wie ständig befürchtet, allein zurückgeblieben waren. Wir liehen uns erst mal einen etwas größeren Schlitten und holten die im und am Bahnhof zurückgelassenen Koffer. Sie waren noch da,- und wir hätten zahllose der umherliegenden Gepäckstücke aufsammeln können. In der Wohnung gab es weder Strom, noch Gas, noch Wasser mehr. Wer sollte es auch noch liefern? Kerzenlicht erhellte notdürftig die kalte Küche, der Kohleofen wurde angeheizt und Schnee aufgetaut. Aus dem Keller holten wir eingewecktes Obst und naschten aus den Gläsern. Weit über 200 Gläser Eingewecktes standen in unseren Kellerregalen: Erdbeeren, Kirschen, Spargel, Gurken, - was immer auch das Herz begehrte. Wir hätten allein damit wohl ein ganzes Jahr überleben können, wenn es darauf angekommen wäre. Um die Mittagszeit erfuhren wir von Nachbarn, daß vom Marktplatz ab und an Munition anliefernde Militärfahrzeuge auf der Rückfahrt ins Hinterland Zivilpersonen mitnehmen würden. Also wiederum auf zum Marktplatz. Viele Menschen harrten dort bereits hoffnungsvoll aus. Aber nach stundenlangem vergeblichen Warten, hieß es auch hier: "Nichts geht mehr!" Einmal mehr heimwärts. Da wiederum heftiger Artilleriebeschuß einsetzte, brachten wir Bettzeug in den Keller und versuchten uns dort ein wenig einzurichten. Trotz in naher Umgebung einschlagender Granaten, direkt vor unserem Haus zurückschießender Panzer, schliefen wir ermattet und völlig übermüdet mehr oder weniger kurzzeitig ein. Am Morgen blickten wir wiederum vorsichtig auf die Straße und erfuhren, daß fast die gesamte Nachbarschaft die Nacht im großen sicheren Kellergewölbe des nahegelegenen Amtsgerichts zugebracht hatte. In jeder Ecke unserer Straße standen kampfbereite Soldaten, - wir befanden uns inmitten der Kampflinie. Es blieb uns also kaum noch Aussicht auf ein Entkommen. Wieder hieß es, Fahrzeuge nahmen von der Post aus Zivilpersonen aus der fast eingekesselten Stadt mit. Sofort machten wir uns wieder auf den Weg. Diesmal nahmen wir aber nur die 2 kleinen Koffer mit. Es war ja sowieso sinnlos. Unterwegs erblickten wir zum erstenmal die Folgen der Beschießung. An vielen Gebäuden waren schwere Schäden entstanden. Kaum ein Fenster war noch erhalten geblieben. Und immer wieder jaulten Geschosse über unsere Köpfe hinweg. Am Postgebäude mußten wir sofort den Keller aufsuchen. Ankommende Sanitätsfahrzeuge nahmen verständlicherweise nur Verwundete mit. Erst nach wiederum stundenlangem Warten traf ein Munitionstransporter ein. Nach dem Entladen konnten wir gemeinsam mit etwa 20 anderen Personen den leider nur offenen LKW besteigen, - und ab ging die Fahrt auf unsicherer, dick verschneiter Straße aus unserem Heimatort. Richtung West! ...zigmal waren wir mit allem möglichen Gepäck in der Stadt umhergeirrt, - und nun als es wirklich fortging, besaßen wir nur noch unsere Decken, die Lebensmitteltasche und 2 kleine Koffer. Es ging in Richtung Kotzenau, auf der wohl einzig noch feindfreien, wenn auch vom Feind einsehbaren und unter Beschuß liegenden Straße fort. Wann würden wir zurückkehren in die Heimatstadt, die Stadt meiner Kindheit ? Noch glaubten wir, es würde nur für einige wenige Tage sein! Dr. Manfred BürgerZeichnungen von Theo Dames, Franz Diener und aus der Chronik von Konrad Klose |
