
Erinnerungen von Arnold Weidner (1922-2009) - Teil 1 |
Von Arnold Weidner aus Lüben-Altstadt habe ich kürzlich einen amüsanten mundartlichen Text veröffentlicht. Meine Nachfrage bei seiner Witwe Ingeborg geb. Müller brachte Unglaubliches zutage! Da existieren von beiden schriftliche Aufzeichnungen über das Leben in Lüben,
Teil 1
Teil 2: Was in Altstadt so alles passierte
Teil 3: Altstädter Anekdoten
Teil 4: Lübener Originale
Bilder der Altstädter Kirche
|
Teil 1 - Unter Linden und Maulbeerbäumen Ich habe sie in guter Erinnerung, sie standen an der rechten Seite des Weges, der an dem Oberauer Feld meines Vaters entlangführte. Von diesen großen, im Wuchs ausgewachsenen Eichen ähnlichen Bäumen war es nur einen Steinwurf weit zu unserem Feld. Leider standen sie an einer gut zwei Meter hohen Böschung. Wir Kinder konnten die Maulbeeren, die noch an den Bäumen hingen, nicht erreichen. Diese Beeren waren das Süßeste, was ich in meinem Leben gegessen habe. Wir konnten sie uns in zwei Farben aussuchen, einmal in Lila oder in Weiß. Sie mußten noch am selben Tage gegessen werden, denn am nächsten Tag waren sie voller Würmer und Maden und nicht zu genießen. Diese Bäume waren, soviel ich weiß, die einzigen ihrer Art in unserem Heimatkreis. Im Jahre 1911 stand da noch eine stattliche Allee, aber bis auf diese fünf oder sechs Bäume, die unter Naturschutz standen, wurden sie gefällt. Wahrscheinlich waren sie den Getreidewagen auf dem einspurigen Weg ein zu großes Hindernis. Ein großer Teil des anfallenden Holzes wurde zu Zaunpfählen verarbeitet und die haben bis in die Jahre 1936/37 gehalten. Wir hatten danach große Mühe, die verhältnismäßig dünnen Pfähle zu brauchbarem Brennholz zu zerkleinern. |
 | |
|
Als Neuvermählte zogen meine Eltern im Sommer 1911 in den Hof Nummer 34 in Lüben-Altstadt ein, er ist mein und meiner Brüder Elternhaus, die Stätte unserer Kindheit und Jugend. Das Erbteil meiner Eltern reichte nicht aus, um den Hof vollständig zu bezahlen. Der Kaufpreis betrug 40 000 Goldmark, es mußte eine Hypothek aufgenommen werden. Weil zuwenig Ackerland zum Hof gehörte, kaufte mein Vater in der Gemarkung Oberau noch ca. 4 bis 5 ha dazu. Sie hatten zum Hof eine ungünstige Lage, ein langer und unbefestigter Weg mußte befahren werden, wenn wir das Oberauer Feld erreichen wollten. Von Altstadt bis zur Sperlingsmühle war er ein sehr breiter Feldweg, 3 bis 4 Ackerwagen konnten bequem nebeneinander fahren, er wurde "Viebig" genannt. In der Schule wurde uns dieser Name mit Viehtrieb erklärt. An diesem Wege sollen vor Zeiten die Gemeindewiesen gelegen haben; eine Viehherde braucht eben einen solch breiten Weg. Dieser Weg ist sehr hügelig und bei Nässe wegen der tiefen Fahrspuren schwer zu befahren. Bei schwerem Zug, z. B. bei zwei hintereinander gekoppelten, voll mit Kartoffeln beladenen Ackerwagen, wurde ein großer Umweg durch Lüben gemacht. Vom Oberauer Feld ging es in Richtung Oberförsterei auf die Polkwitzer Straße, dann über Hindenburgstraße, Haynauer und Kotzenauer Straße nach Altstadt. |
Nur drei Jahre konnten die Eltern gemeinsam den Hof bewirtschaften, dann begann der verhängnisvolle große Krieg, den wir den ersten Weltkrieg nennen. Als mein Vater als Landsturmmann eingezogen wurde, mußte meine Mutter sich nicht nur um den 1913 geborenen ältesten Bruder Martin kümmern, sondern auch den Hof bewirtschaften. Im Jahr 1915 wurde mein Bruder Johannes geboren und im Winter 1916-1917 begann mit dem berüchtigten "Steckrübenwinter" ein großer Mangel an allen Nahrungsmitteln. Besonders in den Städten herrschte Hungersnot. Onkel Otto aus Kniegnitz, meines Vaters Stiefbruder, war auf französischem Boden in englischer Kriegsgefangenschaft und schrieb auf die bewegte Klage aus der Heimat über den schlimmen Steckrübenwinter nur zurück: Er wäre froh wenn er eine Steckrübe hätte! Meine Mutter hatte bis dahin das Brot selbst gebacken. Aber bei der miesen Mehlqualität reichte der Sauerteig als Treibmittel nicht mehr aus, sie mußte das nötige Brot kaufen. Mein Vater war in Frankreich und in Russisch-Polen eingesetzt. Er wurde nicht verwundet, aber er kam mit einer Tuberkulose aus dem Krieg nach Hause. |
der Familie Weidner. Dort an einem der Feldwege standen die Maulbeerbäume. Größere Karte der Umgebung von Lüben. |
|
Er mußte es vermeiden, sich im Winter im Freien aufzuhalten. Er hat dann Gabeln und Rechen im warmen Kuhstall repariert oder die Kühe geputzt. Meiner Mutter hat er seine Rückkehr mit dem Telegramm "Ich bin wohl und in der Heimat" angekündigt. Noch vor dem ersten Weltkriege hatte mein Vater sich überreden lassen, das Amt des Gemeindevorstehers zu übernehmen. Meine Mutter pflegte es mit "Sie haben eben keinen Dümmeren finden können!" zu kommentieren, denn die Bezahlung war mehr als dürftig und der Zeitaufwand erheblich. Im Jahre 1922 hatten die Stadt Lüben und einige Lübener Bürger Sitz und Stimme in der Realgemeinde von Lüben-Altstadt. Nach langen Verhandlungen war es soweit: Altstadt wurde nach Lüben eingemeindet. Meinem Vater oblag als letztem Gemeindevorsteher die für Altstadt bestimmte Ausfertigung des Vertrages zwischen Altstadt und Lüben. Den habe ich mehrmals durchgelesen und ich erinnere mich an folgende Vereinbarungen:
| |
Mit Sicherheit war in diesem Vertrag noch manch anderer Passus zu finden, aber mir sind nur diese vier in Erinnerung geblieben. Die großen Siegel und die bunten Siegelschnüre habe ich stets bewundert. Noch eine Kuriosität aus dieser Zeit: Als letzter Gemeindevorsteher von Lüben-Altstadt erhielt mein Vater einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung Lüben. Die Stadt Lüben kaufte in dieser Zeit einen Forst in der Nähe von Kotzenau, den Krebsberg. Nach Abschluß des Kaufvertrages wurde in diesem Forst für jeden der Stadtverordneten eine Eiche gepflanzt. Zur Ehre meines Vaters und seiner Nachkommen, so pflegte mein Vater zu sagen, steht irgendwo und irgendwann im Kreise Lüben eine hundertjährige Eiche, eine Weidner-Eiche, wenn sie noch nicht umgefallen oder gefällt worden ist. Als mein Vater den Hof kaufte, stand in der Scheune eine mit einem Göpel betriebene Stiftendreschmaschine. Als es noch keine Elektromotoren gab, wurden mit dem Göpel viele Maschinen in der Land- und Forstwirtschaft, in Sägewerken, Fabriken und im Bergbau betrieben. Für die Pferde im Bergbau unter Tage bedeutete dies ein Leben in dauernder Finsternis. Die neue Technik bedeutete das Ende eines oft erbarmungswürdigen Daseins. |
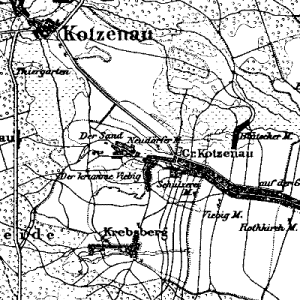 Der Krebsberg bei Kotzenau. Auch hier gab es |
Die Familie Weidner im Haus Lüben-Altstadt Nr. 34 wurde größer: am 16. März 1922 erblickten mein Bruder Konrad und ich das Licht der Welt. Mir gaben meine Eltern den Namen Arnold, weshalb ich diesen seltenen Namen erhalten habe, weiß ich nicht, ich habe auch niemals danach gefragt. Am 11. Mai 1926 wurde mein jüngster Bruder Gerhard geboren, mit ihm war die Familie komplett. Meine Mutter hätte auch gern eine Tochter gehabt. Aber es blieb bei den fünf Jungen. Ostern 1928 war es für Konrad und mich soweit: Mit Schiefertafel mit dem dazugehörigen Schwamm und Trockentuch, einem kleinen Holzkästchen, das mehrere Schreibgriffel enthielt und der ersten obligaten Fibel für ABC-Schützen ausgestattet, sollten wir unter der energischen Anleitung und Aufsicht von dem Herrn Schröther, seines Zeichens Kantor und Lehrer in Lüben-Altstadt die Kunst des Lesens, Schreibens und Rechnens erlernen. Zuerst lernten wir die Signale der Feuersirene kennen: ein langgezogener Ton = Feuer in Lüben, zwei Töne = Feuer in einem Dorf, drei Töne = Waldbrand, vier Töne = Feuerwehrübung. Als Nächstes wurde geübt, den Herrn Kantor beim Eintritt ins Klassenzimmer vorschriftmäßig zu begrüßen. Alle Schüler sagten gemeinsam in singendem Tonfall "Gott grüße Sie!" An seinem Geburtstag wurde das Lied: "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" gesungen und die Zeile "der deinen Stand sichtbar gesegnet" gefiel ihm ganz besonders. Die Mädchen haben den großen Zeigestock und den kleinen Bambusstock sinnigerweise mit viel Mühe mit Blumengirlanden umwickelt und sind jedesmal in ein klägliches Wehgeheul ausgebrochen, wenn er die Girlanden entfernen wollte, um die Stöcke zu so profanen Zwecken wie zum Zeigen oder zum Abstrafen eines Schülers zu mißbrauchen. Aber irgendwann zog die Masche nicht mehr und es gab wieder die gewohnten Strafen. In einem Schuljahr war er mein Klassenlehrer und da fiel etwas auf. Es war eine gemischte Klasse, Jungen und Mädchen, und wenn ein Junge gefragt wurde und wußte die Antwort nicht sofort, kam der Nächste dran. Die Mädchen bekamen Zeit und Hilfe: Na, überlege mal - und - du kannst es doch - usw. Am Ende des Schuljahres haben einige Kinder ihre Zeugnisse verglichen und der Kantor durfte durch das geöffnete Fenster "Schiebung, Schiebung" hören. Mein älterer Bruder Martin war auch bei ihm in die Schule gegangen und meinte, wir hätten Glück, der Kantor Schröther sei älter geworden und weniger mit dem Rohrstock beschäftigt als früher. Er legte viel Wert auf eine saubere und schöne Schrift und gutes Benehmen auch auf der Straße und, für Konfirmanden wichtig, besonders im Gottesdienst. An so manchem Montag wurden die nicht immer reuigen "Täter" zur Rechenschaft gezogen: Du hast gelacht, du hast gesprochen und du hast deinen Nachbarn gestoßen! Wenn er auf der Orgelbank saß, bewegte er sich ziemlich auffällig vor dem Rückblickspiegel hin und her, er wollte möglichst alle seine Schutzbefohlenen im Auge behalten. Weil ich ein Jahr lang mit zwei anderen Kindern geläutet habe, habe ich genügend Zeit gehabt, um die gymnastischen Fähigkeiten unseres schon in die Jahre gekommenen Kantors zu bewundern. | |

|

|
|
Den Schulkindern hat er viel beigebracht. Als die Schule 1932 mitten im Schuljahr wegen mangelnder Schülerzahl aufgelöst wurde haben die Lehrer uns "Altstädter", sehr zum Ärger der übrigen Kinder, als Vorbilder in Sachen Schönschreiben hingestellt. Die Schule in Altstadt hatte als Dorfschule einen anderen Lehrplan und so kam es daß ich manchen Lehrstoff zweimal und anderen überhaupt nicht, besonders in Heimatkunde, gelernt habe. Mein Zwillingsbruder Konrad und ich kamen in verschiedene Klassen. Mein Bruder Gerhard hat die Schule in Altstadt nicht mehr besucht, er wurde gleich in Lüben eingeschult. |
|
In den Ferien war es für einen Bauernsohn eine Selbstverständlichkeit, von Früh bis Abend überall zu helfen. Denn auf einem Hof gibt es viele Arbeiten, die auch Kinder ohne Schaden tun können. Und manche machten sogar Spaß, wie die Heuernte. Da ich sehr gern in der Militärbadeanstalt baden ging, das aber meist nur am Abend nach Feierabend möglich war, habe ich mich oft aus Selbstmitleid gefragt: "Warum muß gerade mein Vater eine kleine Landwirtschaft haben?" Es war ja nicht nur die Arbeit auf dem Feld. Der Hof und die Straße mußten gefegt werden. Im Winter mußten Schnee geräumt werden, Kartoffeln abgekeimt, Rüben abgekratzt und beim Dreschen in der Scheune geholfen werden. Wenn im Sommer so gegen 15-16 Uhr am Samstag die Straße bei uns noch nicht gefegt war, wurden wir Kinder nachdrücklich an unsere Pflicht gemahnt. Aber wir hatten herrliche Spielmöglichkeiten. Die Scheune, der Heuboden, der Schuppen und die Ställe standen uns zur Verfügung, wenn wir Verstecken oder Fangen spielen wollten. Und dann gab es ja noch den Feuerlöschteich gleich über der Straße. Mit dem Brühtrog, in dem die geschlachteten Schweine abgebrüht wurden, sind wir "Kahn gefahren". Da wurden Seeschlachten mit Holzäpfeln ausgefochten. Nur baden konnten wir nicht, denn das Wasser war zu schmutzig. Die Ackerkutscher vom Dominium ritten mit den Pferden durch die Schwemme und im Winter wurde bei guter Eisoberfläche eifrig Schlittschuh gelaufen. |
 Die Militär-Badeanstalt an der Kalten Bache |
Wenn das Eis genügend dick gefroren war, ließ Herr Laux, der Pächter des Dominium, zu dem der Teich gehörte, für seinen Milchkühlraum breite Eisstangen heraussägen. Dann aber war Vorsicht geboten, um nicht in das offene Wasser zu fallen. Mit Heino, dem Sohn von Herrn Laux, habe ich einige Zeit zusammen gespielt. Von seiner Großmutter mütterlicherseits bekam er viel Spielzeug. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage: Er hatte einen Berg Spielzeug. Er war ein guter Spielkamerad. Es tut mir leid, daß er gefallen ist. Sein Vater war der geborene Befehlshaber. Ihn konnte man weit hören und er brauste leicht auf. Die Frau Schwarz hatte mal bei ihm Rüben im Akkord gehackt und nach seiner Meinung zuviel verdient. Er wollte deswegen den vereinbarten Lohn nicht auszahlen. Nach einem heftigen Wortwechsel warf er Frau Schwarz einige Lohntüten vor die Füße: Hier haben Sie mein ganzes Geld! Ganz unbeeindruckt erwiderte sie: Ich brauch euer Geld nicht, ich will euer Geld nicht, ich will MEIN Geld! Später war er Kreisbauernführer und hat sich meinen Eltern gegenüber, die schon zwei Söhne im Krieg verloren hatten, schäbig benommen. Lustiger war eine Begebenheit, die sich im unseren Haus abspielte. Einer seiner Ackerkutscher wollte bauen und Herr Laux war zum Schluß gekommen, das ließe sich am besten in unserem Obstgarten verwirklichen. Für Herrn Tschierschke wäre es ideal gewesen, die Hälfte von unseren Obstgarten samt angrenzenden Bauland - so etwas bekommt man nicht alle Tage. Dabei hatte Herr Laux hinter seiner Scheune ebenfalls einen riesigen Obstgarten. Aber er befürchtete mit Recht, dann würde er von seinem Obst nicht mehr viel sehen. Herr Laux bewirtschaftete 550 Morgen Land, mein Vater 50 Morgen. In Anspielung darauf sagte mein Vater, das ist ja so, wie es in der Bibel steht. Herr Laux fuhr auf: Wieso denn? Ja, das ist so, da wollte ein Mann mit 100 Schafen mal einen Hammelbraten essen und nimmt einem armen Mann sein einziges Schaf weg. Herr Laux war über den Vergleich außer sich und verließ empört unser Haus. Herr Tschierschke konnte trotzdem bauen. Denn der Nachfolger von Kantor Schröther, der Lehrer Bartsch, der auch noch in der Altstädter Schule wohnte, legte keinen Wert auf das Schulland und das notwendige Bauland stand zur Verfügung. |
|
 Geschäftspost und Firmenanzeige Fa. Max Priesemuth |
 |
1936 war meine Schulzeit zu Ende. Während Konrad eine Lehre bei der Firma Priesemuth in Lüben auf der Bahnhofstraße begann, blieb ich auf dem Hof. Außer die Sense perfekt zu handhaben, habe ich alle vorkommenden Arbeiten gelernt - auch die Kühe melken, was überraschender Weise eine anstrengende Arbeit ist. Martin konnte dagegen sehr schnell und gut mit der Sense mähen. Als ich anfing, wurde bald eine Mähmaschine zum Grasmähen gekauft. Die Milchkannen mit der früh gemolkenen Milch mußten schon um 5.30 Uhr zum Abholen bereit stehen - also früh aufstehen war die Parole. |
 |
|
In den dreißiger Jahren waren Ferienkinder bei uns. Einmal waren es zwei Töchter des ehemaligen Predigers in der Gemeinschaft in Lüben, Herr Ruhnke. Die Ältere hieß Hanna und die Jüngere Lydia. Hanna hatte sich als Opfer ihrer Streiche ausgerechnet mich ausgesucht hatte, denn ich war nur einige Jahre älter und - ich war anwesend. Einmal an einem heißen Sommertag schüttete sie mir völlig unerwartet einen halben Eimer Wasser, frisch aus dem Brunnen, nichtsahnend über den bloßen Oberkörper. Es hat mir buchstäblich die Sprache verschlagen, ich bekam kaum Luft. Sie wußte, daß sie durch meine Mutter vor einer entsprechenden Gegenreaktion geschützt war. Irgendwann hatte sie einen harten Tennisball aufgegabelt und mich mit großem Eifer beworfen und auch einige Male zu ihrer großen Freude empfindsam getroffen. Als ich sie dann einmal richtig getroffen hatte, ging sie heulend zu meiner Mutter und ich bekam zu hören, daß man ein Mädchen nicht mit Bällen bewirft. Die Welt ist ungerecht... Einmal erhielten die Mädchen den Auftrag, im Garten Johannisbeeren zu pflücken, und bekamen einige Gefäße. Ein irdener Topf war auch dabei. Hanna trieb soviel Allotria und so gingen kurz hintereinander zwei Töpfe zu Bruch. Das war selbst der übermütigen Hanna unangenehm. Sie gab meinem Bruder Konrad Geld, um einen neuen Topf zu kaufen. Meine Mutter, die uns Jungen immer wieder beteuert hatte, um wieviel artiger die Mädchen wären, sagte nach der Abreise der Mädchen sichtlich erleichtert zu uns: Es war ja ganz schön, daß die Mädchen hier waren, aber im Moment bin ich doch froh, daß sie weg sind. Das war Balsam für mein Herz! Die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes, Wünsche und Neigungen des Ehepartners, die Zahl der Kinder und oft genug auch existenzbedrohende wirtschaftliche Krisen bestimmten Art und Umfang des Arbeitseinsatzes der Frauen im Betrieb. Krankheiten des Mannes oder der Frau erzwangen manchmal den Einsatz der ganzen Person bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Und das oft über Jahre hinweg. Heute so selbstverständliche Erleichterungen wie einen Urlaub ohne Pflichten, eine Reise nur zum Vergnügen, das waren unerfüllbare Wunschträume. Ein Sonntag ohne Arbeit im Stall war nicht möglich. Um fünf Uhr früh war aufzustehen und dreimal in den Stall: Kühe melken, füttern, oft auch den Stall ausmisten, die Schweine und das Federvieh versorgen und die alltägliche Arbeit im Haushalt, das alles gehörte zum Sonntag der Landfrauen wie der Gang in die Kirche. Und ich habe den Eindruck, es wurde früher weniger geklagt und geseufzt. Die Menschen waren mit viel weniger zufrieden, sie sahen die kleinen Freuden besser: eine Blume, ein lachendes Kind, den geruhsamen Feierabend. Meine Mutter zitierte oft: Ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand hat seine Last; genieße, was dir Gott beschieden, entbehre gern, was du nicht hast. Mein Elternhaus war zweistöckig. Das obere Stockwerk war ein sogenanntes Kniestockwerk, das heißt die Dachschräge begann in derselben Höhe vom Fußboden, wie ein Mensch groß ist, wenn er sich hinkniet. Durch die Haustür kam man in einen geräumigen Hausflur. Geradeaus, gegenüber der Haustür, befand sich die Tür zur Küche. Die Küche war an Wochentagen Küche, Eßstube und Wohnraum zugleich. Rechts neben der Tür standen ein kippbarer Kartoffeldämpfer. Mit ihm wurden die Kartoffeln für die Schweine gar gedämpft. Daneben stand ein eiserner Backofen mit zwei mit Schamotte ausgekleideten Fächern zum Backen. Vor diesem Backofen befand sich die Tür zur selten benutzten guten Stube. An der linken Seite führte eine Treppe, die nach vier Stufen einen Treppenabsatz hatte, zum Gewölbe, einem Vorratsraum für Mehl und Zucker, die in Säcken von der Mühle oder der Zuckerfabrik geholt wurden. Darunter war der Keller mit seinem aus Steinen gemauerten Gewölbe. Von da führte die Treppe im rechten Winkel in das obere Stockwerk. Rechts von der Treppe war ein Flur, in dem unter anderen Dingen eine kleine Wäschemangel stand und links war gleich das Schlafzimmer für meine Brüder Martin, Johannes, Konrad und mich. Und hier büffelte Johannes auch seine Vokabeln. Rechts und links waren zwei Alkoven, einer wurde als Abstellkammer genutzt, der andere war der Schlafraum für das Dienstmädchen und hatte einen Vorraum. Daneben, auch an der Straßenseite, war ein zweiter Raum, in den die massive Räucherkammer eingebaut war. Durch eine Tür neben der Räucherkammer gelangte man in den Schüttboden. Gleich linker Hand führte eine Treppe zum Schüttboden. Die ganze Fläche war mit 50-60 cm hohen Brettern in drei große Schüttflächen aufgeteilt, in denen das Getreide, nach Roggen, Weizen, Hafer und Gerste getrennt, gelagert wurden. Bei Teilen der Wirtschaftsgebäude bestanden die Wände noch aus Fachwerk. Dieses ließ mein Vater durch Mauerwerk ersetzen, es war sicher eine kostspielige Sache. Die Stiftendreschmaschine und der Göpel wurden durch Dreschmaschine mit Schlagleisten ohne Reinigung und einen 4 ½ -PS Elektromotor ersetzt. Ohne Reinigung bedeutet, die Körner und die Spreu fielen zusammen unten aus der Dreschmaschine heraus, sie mußten anschließend mit einer mit der Hand betriebenen Maschine getrennt werden. Das Stroh kam hinten, auf der anderen Seite der Dreschmaschine heraus, es fiel auf einen Schüttler. Die restlichen Körner und Spreu fielen unter dem Schüttler auf den Boden und mußten in Abständen weggeräumt werden. Das Stroh mußte von Hand gebunden werden. Eine mühsame Arbeit, die etwas kitzlig wurde, wenn das Stroh mit Disteln garniert war. Das Dreschen war die Hauptarbeit für so manchen Wintertag. Das Jahr 1926 war für die Bauern in unserer Gegend ein sehr hartes Jahr. Es fiel sehr viel Regen und es konnte so gut wie kein verwertbares Getreide in die Scheunen gefahren werden. Es war auf den Feldern so naß, daß sogar die Runkelrüben, auch Futterrüben genannt, zum größten Teil verfault waren und ebenso die Zuckerrüben. Auch vom Getreide konnte kaum etwas geerntet werden. Das Einzige, was geerntet werden konnte, waren Futterpflanzen wie Luzerne, Klee und Gras. Die großen finanziellen Verluste brachten viele Bauern in große Schwierigkeiten. Bei meinem Vater kam noch ein weiteres Unglück dazu. Meine Eltern waren mit der Kutsche Sonntag Nachmittag zu Verwandten gefahren und ein Dienstmädchen sollte das Vieh versorgen. Als Futter war nur ganz junger Klee vorhanden, der aber unbedingt mit Stroh vermischt werden mußte, weil reiner Klee für die Kühe lebensgefährlich ist. Aus Sorglosigkeit und Faulheit hat das Mädchen es nicht getan. Als meine Eltern wieder nach Hause kamen, fanden sie die Hälfte der Kühe tot am Boden liegend vor. Es war eine Katastrophe für meine Eltern, denn die Gebäudereparaturen und der Kauf der Maschinen hatte eine angespannte finanzielle Lage zur Folge. Nach dem Unglück im Kuhstall waren die anderen Bauern im Dorf überzeugt, meine Eltern können den Hof nicht mehr halten. Das Urteil war: Der Weidner-Bauer macht pleite. Nur durch die allergrößte Anstrengung und Sparsamkeit in der persönlichen Lebensführung und, wie sie es ausdrücklich immer wieder betont haben, der Hilfe ihres Gottes, zu dem sie sich auch in der NS-Zeit öffentlich bekannten, war es ihnen möglich, den Hof nicht nur zu halten, sondern auch meinen Bruder Johannes auf das Gymnasium zu schicken und Ende der dreißiger Jahre alle Schulden zu tilgen. Meine Mutter hat damals Übermenschliches geleistet. Sie hat fünf Kinder und den Haushalt, die Schweine und das Federvieh versorgt, die Kühe gemolken, den Gemüsegarten gepflegt und auf den Feldern sehr viel mitgeholfen. Es begann im Frühjahr damit, daß sie Gurken einkeimte, Weiß- und Rotkohlpflanzen aufzog, Karotten und Pferdemohrrüben vereinzelte und mehrmals durchhackte. Dieselbe Arbeit war wenig später bei den Zucker- und Futterrüben fällig. Danach begann die Getreideernte und so ganz nebenbei wurden die Gurken abgelesen, jeden Tag die Hälfte von den angebauten Gurken. Nacheinander wurden der Weizen, der Roggen und die Gerste abgeerntet. Der Hafer wurde als letztes Getreide reif. Wenn der Wind über die Haferstoppeln wehte, ging es mit dem Sommer zur Neige. Nun wurde es langsam Zeit, das Grummet zu ernten, den zweiten Grasschnitt, um Heu für den Winter zu gewinnen. Es folgte die Hackfruchternte, das waren bei uns die Kartoffel-, Zucker- und Futterrübenernte. Dazu kamen noch die Karotten und die gelben großen Pferdemohrrüben. Damals haben sich viele Kinder gern ein Taschengeld verdient. Das Kartoffellesen war überaus beliebt, denn die meisten Bauern gaben immer einen Korb Kartoffeln mit. Die Eltern der Kinder rechneten fest mit dieser Zugabe. Bei der Rübenernte dagegen gab es kaum Arbeit für fremde Kinder, da war nur die Mithilfe der eigenen Kinder eingeplant. Damals wurde die Rübenernte fast nur mit Handarbeit erledigt. Nur Herr Laux setzte Rodegeräte für Zuckerrüben ein, die aber damals noch nicht mit gutem Erfolg arbeiteten. Mit einem gegabelten speziell geformten Rübenroder wurden die Zuckerrüben bei der Rodung mit der Hand und erheblichen Kraftaufwand einzeln aus dem Boden gezogen und in Reihen abgelegt. Später wurden die Blätter mit einem sichelförmig gebogenen Rübenhackmesser mit einem kräftigen Hieb mit einer dünnen Scheibe von der Rübe abgehackt. Das war durchweg Frauenarbeit. Schon während der Getreideernte wurden erste Vorbereitungen für die nächste Aussaat getroffen. Sobald Felder frei waren, wurde Mist und Jauche auf die Felder gefahren. Zumindest wurden abgeerntete Felder geschält, das heißt flach gepflügt, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. Das spätere tiefe Pflügen für eine Saat wird dadurch wesentlich erleichtert. Oft mußte wegen der Fruchtfolge die Kartoffel- und Rübenernte abgewartet werden. Für die Feldarbeit hatten meine Eltern die Frau Viereck. Sie kam tageweise auf Wunsch, denn für meine Mutter war es ohne sie einfach zuviel. Frau Viereck half auch beim Wäschewaschen und im Winter beim Getreidedreschen mit der kleinen Dreschmaschine. Das konnte eine sehr frostige Angelegenheit sein. Rübenroden wurde meiner Mutter zu schwer. Aber Rüben abgehackt hat sie bis zuletzt. Das Winter 1928-29 war ein sehr strenger mit viel Schnee. Es erfroren außer den Sauerkirschen alle Kirschbäume, dazu unser einziger Walnußbaum. Auch der Wein, der am Giebel des Wohnhauses rankte, war unwiederbringlich dahin. Im selben Jahr starb unsere Lieblingstante, die Tante Anna aus Klaptau, eine jüngere Schwester meiner Mutter. Um sie hat die Familie lange getrauert. Sie war bildschön und die Liebenswürdigkeit in Person. Wenn sie zu uns nach Altstadt kam, sind wir Kinder ihr entgegengestürmt mit der für uns Kinder so wichtigen Frage: "Hast du was mitgebracht?" Meine Mutter hat vergeblich versucht, uns zurückzuhalten. Aber Tante Anna ertrug das Drängen von uns "drei Kleinen", wie meine Brüder Konrad, Gerhard und ich immer genannt wurden, nicht nur mit Fassung, sondern freute sich über unsere Anhänglichkeit, obwohl sie auch den mitgebrachten Süßigkeiten galt. Unsere Kniegnitzer Tante Anna war aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Sie kam fast nur an Werktagen, um meinen Eltern bei der Arbeit zu helfen. Sie tat es auch in Kniegnitz bei meinem Onkel Otto. Wenn wir sie auf ihrem Rad sahen, ließen wir uns nach Möglichkeit nicht sehen. Eine ihrer ersten Fragen war: "Wo sind die Kinder?" Die Antwort, sie seien noch in der Schule, gefiel ihr nicht. Sie hätte im vorigen Jahrhundert nicht soviel Schule gehabt und könne auch Lesen und Schreiben. Die Schularbeiten können die Kinder auch nach Feierabend machen. Die denkbar schlechteste Antwort war die, wir seien irgendwo um zu spielen. Sie meinte es wirklich gut mit uns, nur war das damals für uns Kinder eben nicht erkennbar. Meine Mutter sagte manchmal: "Sie hat ein Tantenherz und kein Mutterherz." Sie hatte sehr flinke Hände, ich habe später gern mit ihr gearbeitet. Sie hatte viele belehrende Sprüche zur Hand: "Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen", oder: "Jedes Ding an seinem Ort, das spart viel Zeit und Müh". Das lässige: "Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen" war noch nicht im Schwange. Sie zitierte auch: "Du wolltest ein Blümlein begießen, da lag es vertrocknet zu deinen Füßen; du kamst zu spät, zu spät". Da gab es einige Verse und alle endeten mit: "du kamst zu spät!" Eine unüberhörbare Aufforderung, alles sofort zu tun. Sie fühlte sich nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, mir die richtige Einstellung im Leben zu vermitteln. Na, sie war meine Patentante, sie sagte oft: "So halber gehörst du mir." Zu meiner Erleichterung sah das meine Mutter etwas anders.
Altstadtschüler mit ihrem Kantor und Lehrer Theodor Schröther. Weil Arnold Weidner 1975 das Foto an die Lübener Heimatzeitung geschickt hat, ist davon auszugehen, dass zumindest einer seiner Brüder auf dem Bild ist. Aber wo? Wer kann die Namen zum Bild mitteilen? Ostern 1935 bestand mein Bruder Johannes als Bester seines Jahrgangs das Abitur am Lübener Gymnasium. Er wurde sofort für ein halbes Jahr zum Arbeitsdienst nach Raudten eingezogen und anschließend zum Militär nach Liegnitz zu einer Nachrichteneinheit. Ostern 1936 kam ich aus der Schule und auch mein Zwillingsbruder Konrad, der eine Kaufmannslehre bei Firma Priesemuth in Lüben begann, während ich die Geheimnisse der Landwirtschaft kennenlernen wollte. Am 7. Juni feierten meine Eltern ihre Silberhochzeit. Dies war das einzige Familienfest, was etwas größer gefeiert wurde. Außer der Verwandtschaft wurden auch Mitglieder der örtlichen Gemeinschaft eingeladen. An diesem Tage trug mein Vater das EK zweiter Klasse. Ein Herr aus der Gemeinschaft bemerkte bei seiner Rede, der Jubilar sei zwar ohne Orden und Ehrenzeichen aus dem Kriege gekommen... , er hatte das EK nicht gesehen. Die Stimmung war sofort um einiges weniger feierlich. Unsere Familie war nur noch selten vollständig beieinander, Johannes begann 1937 sein Theologiestudium in Breslau. Nach Beendigung seiner Lehre reiste Konrad im Auftrag seiner Firma im oberschlesischen Industriegebiet und besuchte die Kunden seiner Firma. Der Beginn des Krieges gegen Polen traf die deutsche Bevölkerung trotz aller Propaganda unvorbereitet. Deshalb kam eine gedrückte Stimmung auf. "Es wäre diesmal ganz anders als zu Beginn des ersten Weltkrieges", sagte mein Vater und erklärte uns Kindern bestimmt: "Den Krieg haben wir schon verloren". Er rechnete fest mit dem Eintritt Englands und den USA in diesen Krieg. Einen Krieg gegen Polen allein gewinnen wir, bei einem Krieg gegen England können wir mit einigem Glück ein Unentschieden erreichen. Aber an England hängen die USA und die zermalmen ganz Deutschland. Das haben wir 1914-18 erlebt und so kommt es wieder zu einer großen Niederlage. Wie groß die Niederlage sein würde und mit welchen Verlusten an Menschenleben und der Vertreibung von Millionen Menschen aus ihrer Heimat unser Volk für diesen Krieg zur Rechenschaft gezogen werden würde, das konnte selbst mein Vater nicht ahnen. Für ihn gab es nur eine Sorge, wie wird die Antwort des heiligen Gottes auf die Verfolgung des israelitischen Volkes aussehen, wird sie die Vernichtung nicht nur des deutschen Staates, sondern auch des deutschen Volkes sein? 1939 wurde mein ältester Bruder Martin eingezogen. Er kam zu einer bespannten Einheit (bei der alle Fahrzeuge von Pferden gezogen werden) die am Westwall, der Verteidigungslinie an der deutsch-französischen Grenze, eingesetzt war. Da waren mein Vater und ich allein bei alle schweren Arbeiten wie ein- bis eineinhalb Zentner schwere Getreide- und Kartoffelsäcke tragen oder Rüben auf einen Pferdewagen laden und vieles andere mehr. Zum Glück wurde ich in dieser Zeit nicht ernsthaft krank, denn für meinen Vater waren solche Arbeiten mit seiner vom Krieg herrührenden Krankheit schon seit Jahren praktisch eine Überforderung. Außerdem war er schon sechzig Jahre alt und hatte seit seiner Kindheit immer schwer gearbeitet und war auch nicht gerade der Stärkste. 1940 beendete mein Bruder Gerhard die Volksschule und wollte keine Lehre in einem Handwerksberuf beginnen, sondern blieb auf dem Hof. Meinem Vater war er als zusätzliche Arbeitskraft sehr willkommen. So haben mein Bruder Gerhard und ich ein knappes Jahr zusammen auf dem Hof gearbeitet, bis ich im Frühjahr 1941 nach Liegnitz zum Militär eingezogen wurde.Nach dem Urlaub kam ich im Mai 1942 wieder nach Rußland. Meine Brüder Martin, Konrad und Johannes waren inzwischen auch Soldaten und ebenfalls in Rußland. Während Martin bei einer bespannten Einheit war, war Konrad als Fernsprechmann bei einer motorisierten Einheit. Johannes, der vor dem Krieg zum Nachrichtenmann ausgebildet war und zudem das Abitur hatte, war beim Heeresnachrichtenkorps als Offizier eingesetzt. Diese Einheit hatte dafür zu sorgen, daß alle nötigen Fernsprechverbindungen, auch in die Heimat, funktionierten. Und so war es meinem Bruder möglich, die Vermittlung in Lüben anzurufen, um mit seiner Verlobten zu sprechen. Im Juli 1942 erhielten meine Eltern die schreckliche Nachricht vom Tode meines Bruders Martin. Er war am 9. Juli am Don gefallen. Als ich im Frühjahr 1943 nach einer Verwundung nach Hause kam, habe ich zum ersten Male meine Eltern weinen sehen. Er war in der schweren Zeit nach 1926 nicht nur eine große Hilfe gewesen, er war auch äußerst liebenswürdiger und hilfsbereiter Mensch und sehr nachsichtig seinen jüngeren Brüdern gegenüber. Auch das Vieh profitierte von seiner Gutmütigkeit. Einmal trat er in die Futterkrippe, um an dem heißen Sommertag die Stallfenster zu öffnen. Die Tiere sollten mehr frische Luft kriegen. Da stieß ihn der Mastochse und brach ihm ein Bein. Noch im Winter konnte er noch nicht schnell laufen. Wir "Kleinen" bewarfen ihn mit Schneebällen. Erst als wir überhaupt nicht aufhören wollten, drohte er uns: "Na wartet, wenn ich euch kriege!" Aber als er einen von uns erwischte, brachte er es nicht fertig, seine Drohung wirklich wahr zu machen. Seit dem Tage, als das letzte Familienfoto gemacht wurde, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Später haben wir uns daran erinnert: Als Martin in Richtung Pflaumallee zum Bahnhof ging, hat er sich oft zu uns umgedreht. Ob er geahnt hat, daß es ein Abschied für immer war? Wir wissen es nicht.
Das letzte Foto der Familie Weidner aus Altstadt Nr. 34 mit allen fünf Söhnen im Frühjahr 1942.
Vorn Gerhard, Mutter Ida, Vater Gustav, Konrad, oben Arnold, Martin, Johannes. Im Januar 1943 am 14. Januar heirateten Ruth und Johannes, leider konnte ich nicht dabei sein. Der zuständige Arzt im Lazarett wollte mich nicht früher entlassen oder Urlaub geben. Da habe ich die Ente eben später gegessen. Nur habe ich eben als Tischherr gefehlt, das wurde mir bedauernd mitgeteilt. Im Mai 1943 war ich wieder in Rußland und am 7. Juli begann die große Offensive, in der beabsichtigt war, ein russisches Armeekorps einzukesseln. Das Vorhaben schlug fehl, es begann auch dort der Rückzug der Wehrmacht. Am 17. Juli, es war schon dunkel, wurde ich verwundet, es war ein Oberschenkeldurchschuß mit Nervenlähmung. Für mich war der Einsatz an der Front zu Ende. Nicht aber der Krieg... Hier enden hier die mir übergebenen Aufzeichnungen über die Familie Weidner.In den Teilen 2-4 folgen Anekdoten über Lübener Persönlichkeiten. Heidi |
|


